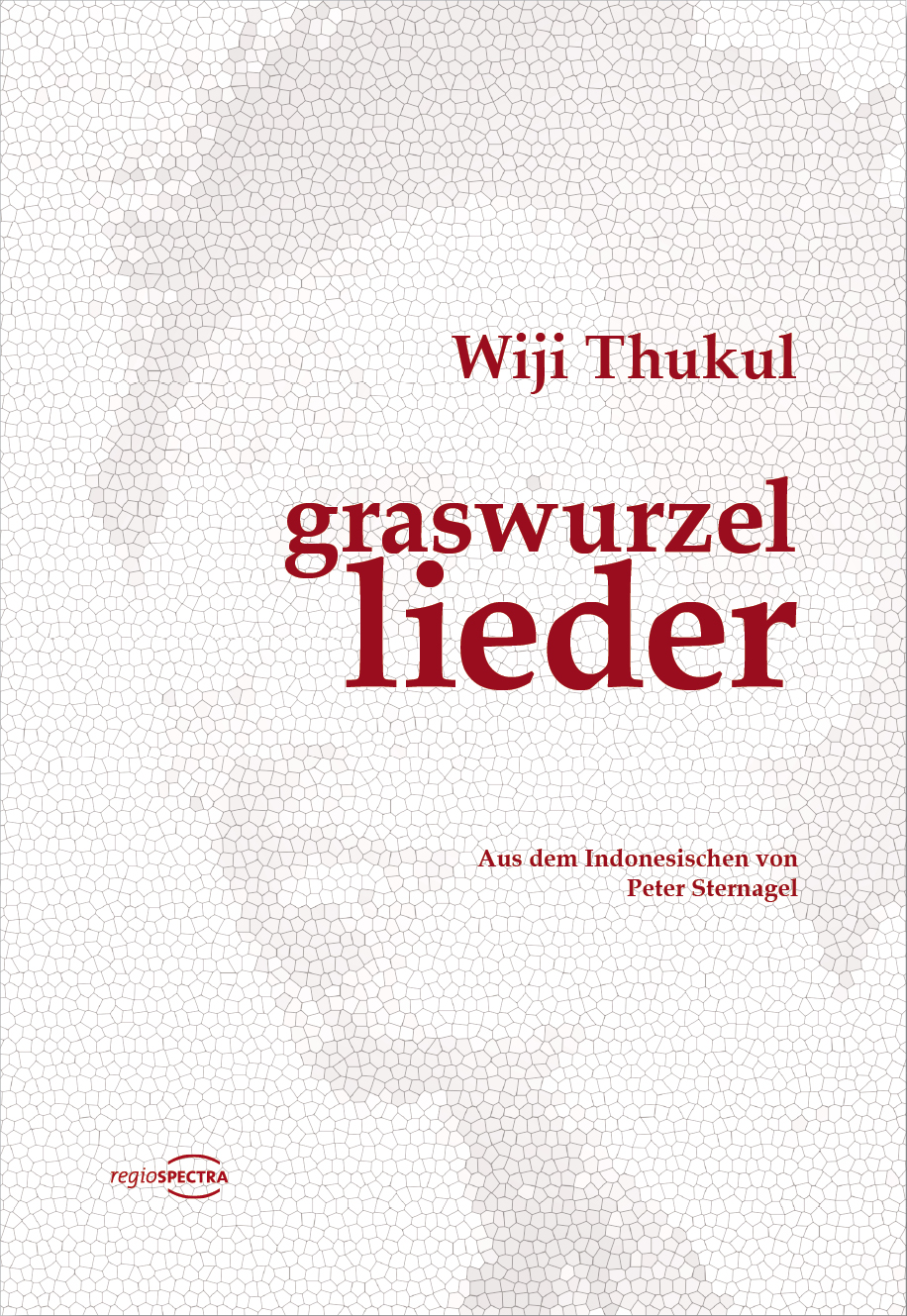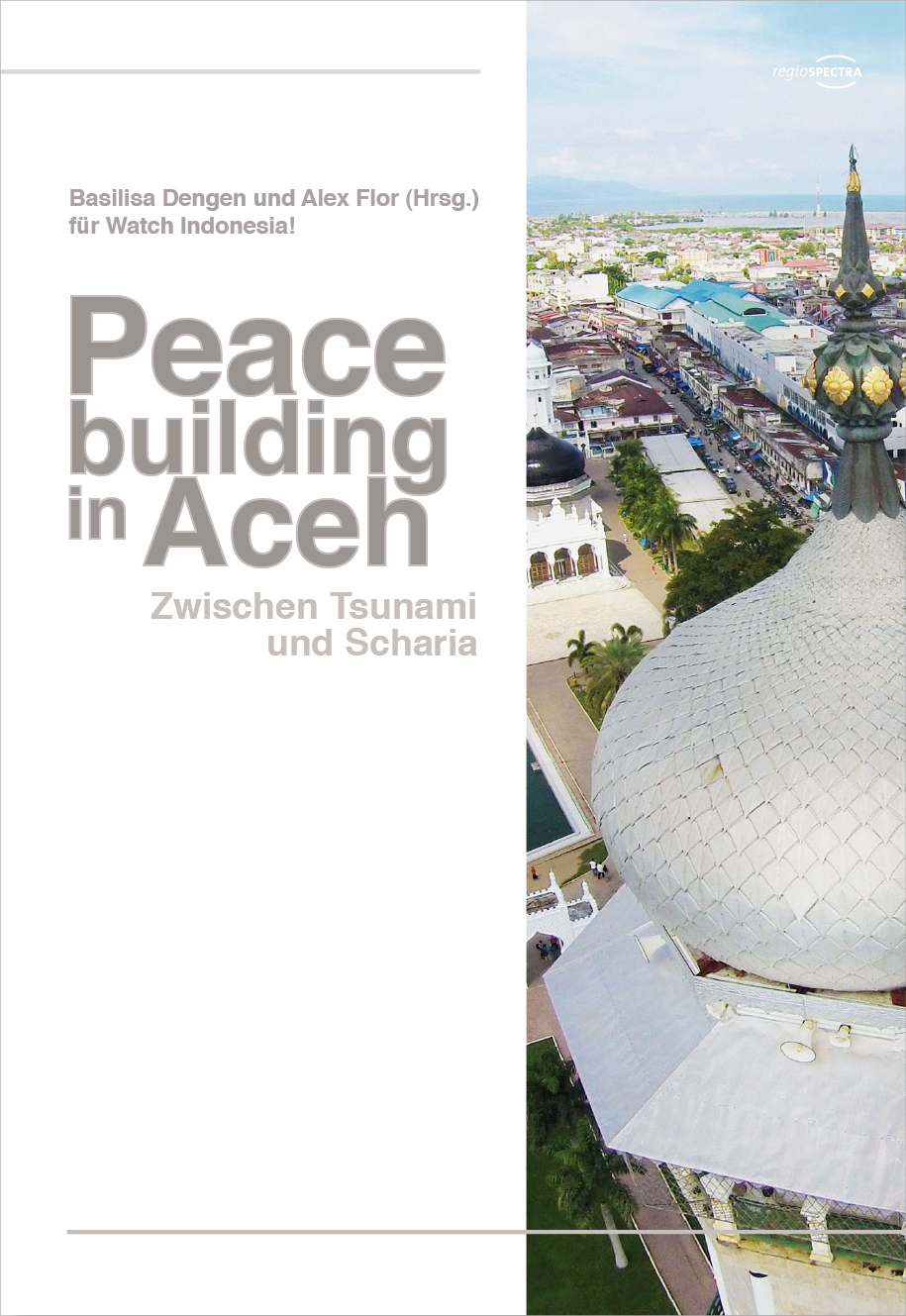Indonesien 1965 – Drei Leben ohne Gerechtigkeit
17. April 2006
von Fabian Junge
In der Nacht des 30. Septembers 1965 entführte und ermordete eine Gruppe junger Offiziere, die sich „Bewegung 30. September“ nannte, sechs Generäle und einen Leutnant der indonesischen Armee, angeblich um einen Putschversuch gegen Indonesiens ersten Präsidenten Sukarno zu verhindern. Die Leichen der Ermordeten warfen die Offiziere in einen als Lubang Buaya bekannten Brunnen nahe der Luftwaffenbasis Halim in Jakarta, in der sie sich verschanzt hatten. General Suharto übernahm am 1.Oktober eigenmächtig das Kommando über die Armee und zwang die Akteure des schlecht vorbereiteten Putschversuches zur Aufgabe. In dem entstandenen Machtvakuum erzwang er seine offizielle Ernennung zum Kommandeur der Armee sowie das Mandat zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Damit verfügte Suharto über die politischen, militärischen und medialen Mittel, um eine Version der Ereignisse vom 30. September zu propagieren, welche die Kommunistische Partei Indonesiens (Partai Komunis Indonesia – PKI) als den Drahtzieher hinter dem Putschversuch darstellte. Den bösen, verräterischen Absichten der PKI wurde in dieser Narration die Armee als einzige Institution, welche die indonesische Gesellschaft vor dieser Bedrohung retten könne, gegenüber gestellt. Um diese Aussagen zu stützen, führte das Militär eine Propagandakampagne durch, in welcher Kommunisten als gottlose Verräter und brutale, perverse Mörder charakterisiert wurden. Fingierte Berichte von der Verstümmelung der Leichen der Generäle in okkulten, sexuellen Ritualen der mit der PKI assoziierten Frauenorganisation Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia – Indonesische Frauenbewegung) wurden hierzu ebenso benutzt wie der angebliche Atheismus der Kommunisten, der sie zu Dämonen und Feinden der Religion mache. Indem man den Putschversuch des 30. Septembers mit der Madiun-Affäre von 1948 in Verbindung brachte und beide Ereignisse der PKI zuschob, erfand Indonesien darüber hinaus seine eigene Dolchstoßlegende vom Verrat der Kommunisten.
Diese Kampagne diente der Legitimierung eines Massenmordes an schätzungsweise 500.000 bis 1 Million angeblichen oder tatsächlichen Kommunisten, der 1965 und 1966 verübt wurde. Vorhergegangene Konflikte und Ressentiments gegen die PKI wurden ausgenutzt, um Lynchmobs und Todesschwadronen aus der Bevölkerung zu rekrutieren und an den Massakern zu beteiligen. Weitaus mehr Personen verbrachten wegen ihrer angeblichen Verbindungen zur PKI Jahrzehnte in politischer Gefangenschaft. Viele starben in den Lagern und Gefängnissen und die Überlebenden werden bis heute diskriminiert und an den Rande der Gesellschaft gedrängt.
Mit der Eliminierung der PKI hatte sich das Militär seines stärksten politischen Gegners entledigt. Nun konnte Suharto Präsident Sukarno aus dem Amt verdrängen und sich selbst an die Spitze der Regierung stellen. Das Trauma der Massenmorde von 1965/66 und Suhartos Version der Ereignisse des 30. Septembers wurde eine zentrale Legitimationsgrundlage der Diktatur Suhartos.
Dieser Artikel beschreibt das Schicksal dreier Opfer der Ereignisse von 1965/66, ihre politische Gefangenschaft und die nachfolgende Diskriminierung und gesellschaftliche Ausgrenzung. Er ist das Ergebnis mehrerer Interviews, die im September und Oktober 2005 in Jakarta durchgeführt wurden.
Surati Djaswadi: „Ich hoffe, dass meine Enkel ein normales Leben führen können“
Surati Suparna binte Djaswadi, geboren im Jahre 1925, lebte 1965 mit ihrem Mann und ihrer Tochter in der mitteljavanischen Stadt Solo. Als Lehrerin und Mitglied in mehreren Vereinen und Organisationen war sie ein geachtetes Mitglied ihrer Gemeinde. Doch sollten die Ereignisse vom 30. September 1965 das bis dahin harmonische Leben Suratis zerstören. Im Oktober 1965 marschierten in Solo Truppen der Armee unter dem Kommando von Hauptmann Sarwo Edhie Wibowo auf und begannen, Männer und Frauen zu verhaften und in der Stadthalle festzuhalten. Auch viele von Suratis Freunden und Kollegen wurden für ihre angeblichen Verbindungen zur Kommunistischen Partei Indonesiens und zu dem Putschversuch vom 30. September verhaftet. Surati und ihr Mann aber waren unbesorgt um ihre Sicherheit, da sie sich keiner Schuld bewusst waren.
Am Abend des 16. Oktobers wurde Suratis Haus von einer Gruppe bewaffneter Jugendlicher aufgesucht. Sie fragten nach ihrem Mann, doch da dieser nicht anwesend war, nahmen sie Surati in das Büro des Unterdistrikt-Vorstehers mit. Obwohl sie maskiert waren, erkannte Surati die Jugendlichen als ihre ehemaligen Schüler. Als sie in dem Büro ankamen, wurde Surati von mehreren Polizisten in Zivilkleidung empfangen, die sie auf die Polizeiwache mitnahmen. Der Polizist, der sie verhörte, war ein Bekannter von Surati und versuchte sie zu beruhigen: „Die Situation ist nicht sicher“, sagte er, „deswegen müssen wir dich beschützen. Morgen bringe ich dich in die Stadthalle.“ So holte Surati am nächsten Tag ihre Tochter ab, und begab sich mit ihr in die Stadthalle. Dort traf sie ihren Mann, der bereits verhaftet worden war. Im Laufe der Wochen füllte sich die Stadthalle, bis dort laut Surati mehr als 1.000 Personen festgehalten wurden. Es waren meist einfache Leute: Arbeiter, Bauern, Straßenverkäufer. Aber auch viele Lehrer waren unter den Gefangenen. Da sie sich keiner Schuld bewusst war, fürchtete Surati sich nicht.
Die Gefangenen wurden von paramilitärischen Jugendgruppen unter dem Kommando des späteren Generals Hauptmann Sarwo Edhie bewacht, der für viele der schlimmsten Massaker an angeblichen PKI-Mitgliedern auf der Insel Java verantwortlich gemacht wird. Bald nach ihrer Ankunft in der Stadthalle hörte Surati Gerüchte über die unmenschliche Folter der männlichen Gefangenen. Mit Schrecken erfuhr sie von der Folterung eines Freundes, dem Direktor einer Sekundarschule, den man mit einer Sichel misshandelt und gezwungen hatte, ein falsches Geständnis über seine Beteiligung an dem Putschversuch vom 30. September abzugeben.
Nach über einem Jahr in der Stadthalle Solos wurde Surati in ein Gefangenenlager in Ambarawa in Mitteljava verlegt, wo sie über fünf Jahre verbrachte. Hier saßen überwiegend Mitglieder der gebildeten Schicht: Lehrer, Professoren, Studenten, und sogar Schüler, die teils nicht älter als zwölf Jahre alt waren. Zu jeweils 50 bis 70 Personen lebten sie in ruinösen Baracken ohne vernünftige sanitäre Anlagen. Die Gefangenen litten unter der rohen Behandlung und willkürlichen Bestrafung der Soldaten. Die kargen Essensrationen hätten nie den Hunger der Gefangenen gestillt, wenn nicht einige von ihnen, wie auch Surati, Essenspakete von ihren Familien erhalten hätten, die sie mit ihren Zellengenossen teilten.
Das Leben nach der Gefangenschaft
Nach ihrer Freilassung im Jahre 1971 musste Surati feststellen, dass der gesamte Besitz der Familie beschlagnahmt worden war. Die kleine Tankstelle, die sie betrieben hatte, war zerstört worden, und ihr Haus wurde nun von einem Beamten bewohnt. So musste die Familie ein Zimmer in einem Wohnheim mieten. So wie Surati selbst durfte auch ihr Mann, der 1968 aus der Gefangenschaft entlassen worden war, seinen früheren Beruf als Lehrer nicht mehr ausüben. Er hatte sich bis zu Suratis Rückkehr als Autowäscher über Wasser gehalten.
Suratis Status als ehemalige politische Gefangene wurde in ihrem Pass vermerkt. Für mehrere Jahre musste sie sich monatlich bei dem Vorsteher ihres Subdistrikts melden. Bis heute muss sie ihren Personalausweis alle fünf Jahre erneuern, während andere Indonesier ab dem Alter von 65 Jahren einen lebenslänglichen Ausweis bekommen. Da Surati nicht mehr als Lehrerin arbeiten durfte, war sie nach ihrer Rückkehr zunächst auf die Hilfe ihrer Nachbarn angewiesen, die ihr Essen gaben und ihr halfen, Arbeit zu finden – zum Beispiel als Straßenverkäuferin, dann in einer Textilfabrik. Später eröffnete sie am Straßenrand einen kleinen Kiosk, wo sie Essen und Zeitungen verkaufte.
Surati und ihr Mann kämpften hart, um ihre Familie durchzubringen. Als ehemalige politische Gefangene mussten sie für ihre Tochter erhöhte Schulgebühren bezahlen. Letztendlich wurde die Tochter im ersten Semester der Sekundarstufe gänzlich der Schule verwiesen. Surati spricht bis heute voller Wut und Trauer hiervon: „Man sagte mir, ich solle nicht wütend sein. Aber natürlich war ich das. Es ist ungerecht. Ich habe die Angestellten in der Schule immer mit Respekt behandelt, bin all meinen bürgerlichen Verpflichtungen nachgekommen. Wir sind nicht in der PKI. Ich litt, und meine Kind litt auch. Meine einzige Hoffnung ist jetzt, dass meine Enkel ein normales Leben führen können.”
Obwohl man ihr verbot, in ihre ehemalige Schule zurückzukehren, hatte Surati nie einen offiziellen Kündigungsbrief erhalten. 1980 versuchte sie, diese Ungewissheit aufzuklären und schrieb an den Minister für Wohlfahrt, um eine offizielle Erklärung über ihren Status als Beamtin zu verlangen. Auch an das Ministerium für Erziehung und Kultur, ihren Dorfvorsteher und den Subdistrikt-Vorsteher wandte sie sich, doch erhielt sie selten eine Antwort und wenn, weigerten sich die Behörden, für ihren Fall die Verantwortung zu übernehmen. Diese Ungewissheit quält die heute 81-jährige Frau immer noch. So betont sie auf die Frage, was Gerechtigkeit für sie heute bedeuten würde: „die Regierung sollte uns rehabilitieren. Kompensation ist zunächst einmal weniger wichtig.“ Vielmehr möchte sie vor dem Gesetz als gleichwertige Bürgerin behandelt werden, ihren Status aufgeklärt wissen und ihren Ruf wiederhergestellt sehen. Außerdem möchte sie von dem „PKI“-Stigma befreit werden und hofft auf Chancengleichheit für ihre Enkel, damit nicht noch eine Generation unter der Diskriminierung leiden muss, die sie und ihre Tochter erfahren haben.
Anwar Umar: „Ich möchte nicht allein in meinem Zimmer sterben“
Anwar Umar wurde als sechstes Kind eines Bauern in Lampung, Sumatra geboren. Mit 16, während der japanischen Besatzung im 2. Weltkrieg, schloss er sich einer paramilitärischen Einheit an und beteiligte sich am nachfolgenden Unabhängigkeitskampf. 1950 ging er nach Jakarta und fand bald Arbeit im öffentlichen Dienst. 1951 heiratete er und wurde Vater von acht Kindern. Nach 14 Jahren in Jakarta, während derer er in zahlreichen politischen Organisationen tätig gewesen war, kehrte Umar 1964 in seine Heimat zurück, um als Assistent des Gouverneurs der neu geschaffenen Provinz Lampung zu arbeiten. Nach kurzer Zeit wurde er hier zum Generalsekretär der Provinzvertretung der Indonesischen Arbeitervereinigung (Serikat Buruh Se-Indonesia) gewählt. Diese Gewerkschaft verfolgte ähnliche Ziele wie die PKI, doch betont Umar, dass er zu keinem Zeitpunkt offizielles Mitglied einer politischen Partei war.
Anwar Umar vor seinem Zimmer
Foto: Fabian Junge
Bald nach den Ereignissen des 30. Septembers 1965 begannen Polizei und Militär angebliche PKI-Mitglieder in Lampung zu verhaften. Obwohl Umar kein PKI-Mitglied war, wurde ihm von einem befreundeten Distriktchef geraten, nach Jakarta zu gehen und dort unterzutauchen.
So reiste Umar am 23. Oktober nach Jakarta. Kurz nach seiner Ankunft bestellte ihn ein Mitarbeiter der Nachbarschaftsverwaltung (Rumah Tetangga/Rukun Warga – RT/RW) in sein Büro. Dort erwartete ihn eine Gruppe von Soldaten sowie mehrere, ebenfalls vorgeladene Männer. Die Soldaten befahlen ihm bei vorgehaltener Waffe sich zu setzen und schrieen immer wieder: „Wer von euch ist Anwar Umar?“, bis Umar sich identifizierte. Daraufhin brachten sie ihn zum „Mis Tijijih“-Gebäude im Viertel Pasar Senen, wo er die Nacht verbrachte. Dies war der Anfang seiner elfjährigen Gefangenschaft.
Ohne dass man ihm die Gründe für seine Verhaftung nannte, wurde Umar am nächsten Tag in ein Gefängnis im Viertel Jatinegara gebracht, welches von der Militärpolizei bewacht wurde. Während der ersten Nächte schlief er mit ca. 800 anderen Gefangenen im offenen Hof der Anstalt. Als aber die Anzahl der Gefangenen auf von Umar geschätzte 3.000 Personen stieg, wurde er mit ca. 60 anderen in eine Zelle verlegt. Hier war es so eng, dass man nur stehen konnte, und so stickig, dass einige der Gefangenen ihren eigenen Urin tranken, da sie von den Wärtern weder Wasser noch Essen erhielten. Nach mehreren Tagen wurde Umar in das Cipinang-Gefängnis verlegt. In der brennenden Nachmittagssonne befahl man den Gefangenen, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen und auf allen Vieren in ihre Zellen zu kriechen. Wer zurückschaute, sah sich den Tritten der Wachen ausgesetzt. Mit ca. 45 Personen in einer Zelle war auch dieses Gefängnis hoffnungslos überfüllt, und es gab weder Wasser noch Nahrung für die Gefangenen. Zu seinem Glück entdeckte Umars Familie eine Woche später seinen Aufenthaltsort und brachte ihm Verpflegung.
Als wären diese elenden Bedingungen nicht genug, sollte Umar einige Tage später durch grausame Folter endgültig gebrochen werden. Als er am Tag seiner Folterung durch den Gefängnishof lief, hörte Umar bereits die schmerzerfüllten Schreie einer Frau. Angsterfüllt wurde er in einen separaten Raum geführt, in dem Polizisten seine Hände mit einem elektrischen Kabel fesselten, dass an eine 20 Volt-Batterie angeschlossen war. Daraufhin folterten sie ihn mit Elektroschocks, was Umar solch große Schmerzen bereitete, dass er laut schrie und am ganzen Körper zitterte. Nach dieser Tortur sollte er ein falsches Geständnis unterzeichnen. In diesem stand, dass Umar als PKI-Kurier zwischen Lampung und Jakarta gearbeitet hatte und dass er an einer Verschwörung zur Ermordung von fünf Generälen beteiligt gewesen war. Seltsamerweise wurden die Namen der Generäle nicht genannt. Umar war verwirrt, da er zu diesem Zeitpunkt nicht genau wusste, was sich am 30. September 1965 in Jakarta ereignet hatte.
Als er sich weigerte, das Geständnis zu unterzeichnen, brachten die Polizisten Umar in ein anderes Zimmer, in dem ihn ca. zehn Polizisten und Soldaten sowie ein Staatsanwalt erwarteten. Sie begannen sofort, Umar zusammenzuschlagen. Ein Polizist schlug solange mit einem Stuhl auf ihn ein, bis dieser unter den schweren Schlägen zerbrach. Ein anderer Polizist griff Umars Kopf und schlug ihn mehrere Male gegen die Wand. Umar blutete und konnte sich kaum auf den Beinen halten, als er in seine Zelle zurück gebracht wurde. Dort riet ihm ein Zellengenosse, der Mitglied des Zentralkomitees der PKI war: „Unterzeichne es (das Geständnis) doch. Das ist besser als zu sterben oder für den Rest deines Lebens Invalide zu sein. Später bringen wir den Fall vor Gericht, und alles wird sich zum Guten wenden.“ Letztlich folgte Umar dem Rat und unterzeichnete das Geständnis.
Einen fairen Prozess hat Umar nie bekommen. Stattdessen wurde er bis 1976 in einem Gefängnis in Tangerang festgehalten. Wie auch in den anderen Gefängnissen waren die Haftbedingungen elend. Der Reis, den die Gefangenen bekamen, war mit Glassplittern oder Sand vermischt. Viele von Umars Zellengenossen starben an Unterernährung oder inneren Blutungen. „Das Essen, das sie uns gaben, sollte uns langsam sterben lassen“, erinnert sich Umar. Um zu überleben, versuchte er seinen Reis von dem Glas oder Sand zu trennen. Dennoch verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Er wäre auf die Gefangeneninsel Buru verlegt worden, wenn er nicht an Unterernährung, Malaria und Hepatitis gelitten hätte. So brachten sie ihn in ein Gefängnis in Salemba, wo er medizinisch versorgt wurde. Nach sechs Monaten kam er zurück nach Tangerang. Hier musste er nun in einem landwirtschaftlichen Projekt arbeiten, dessen Einnahmen an das Militär gingen. Für seine Arbeit erhielt Umar keinen Lohn. Nur seine Essensration wurde ein wenig erhöht.
Das Leben nach der Gefangenschaft
Umar wurde am 26. September 1976 aus der Gefangenschaft entlassen. Dies wurde ihm in einem Brief von Kopkamtib, dem „Kommando für die Wiederherstellung von Sicherheit und öffentlicher Ordnung“, bestätigt. Zunächst stellte man ihn für drei Monate unter Hausarrest, danach musste er sich für weitere sechs Monate wöchentlich bei der Militärpolizei melden. Nach diesen neun Monaten zog er nach Rawasari im Osten Jakartas. Obwohl Umar zwölf Jahre lang als Beamter gearbeitet hat, erhält er bis heute keine Pension, noch konnte er in seinen Beruf zurückkehren. Sein Personalausweis trägt den Stempel „ET“ (ehemaliger politischer Gefangener), der ihn in den Augen von Staat und Gesellschaft als gefährlichen Verräter kennzeichnet. Mit Gelegenheitsarbeiten konnte sich Umar nach seiner Freilassung über Wasser halten.
Auch wurde Umar der Überwachung durch das RT/RW unterzogen. Jeden seiner Besuche musste er hier melden, und mit Fremden, die in die Nachbarschaft kamen, durfte er nicht reden oder diese zu sich einladen. Viele seiner früheren Nachbarn und Bekannten begegneten Umar feindselig und misstrauisch.
Eine von Umars bittersten Erfahrung nach der Gefangenschaft war der Verlust seiner Familie. Seine Frau hatte bald aufgehört, ihn im Gefängnis zu besuchen. Nach seiner Freilassung kehrte er in das Haus der Familie zurück, stellte aber nach zwei Tagen fest, dass seine Frau in dem Glauben, er sei auf der Gefangeneninsel Buru verstorben, einen anderen Mann geheiratet hatte. Umar geriet in einen handfesten Streit mit seiner Frau, der durch seine Kinder und Nachbarn beendet wurde. Später erfuhr er noch, dass sein ältester Sohn während Umars Gefangenschaft Selbstmord begangen hatte. Seit diesen Ereignissen lebt Umar allein und hat keinen Kontakt zu Frau und Kindern, obwohl das Paar nie offiziell geschieden wurde.
Da er arbeitslos ist und keine Unterstützung von seiner Familie bekommt, ist Umar heute von der Barmherzigkeit von Nachbarn und Freunden in der Menschenrechtsorganisation KontraS abhängig, für die er seit mehreren Jahren als Freiwilliger arbeitet. Er lebt in Armut. Das Zimmer in einer Hintergasse von Jakarta, das er sein zu Hause nennt, ist nur fünf Quadratmeter groß. Wasser zum Kochen und Waschen bekommt er aus einem Brunnen. Er lebt allein und bestellt seinen Haushalt allein. „Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen und möchte niemandem zur Last fallen“, sagt Umar. Dennoch setzt er sich weiterhin für seine politischen Ziele ein, nicht nur für die Opfer der Ereignisse von 1965, sondern auch für andere, die unter der drei Jahrzehnte währenden Diktatur Suhartos litten.
Auf die Frage, was für ihn Gerechtigkeit bedeuten würde, wünscht er sich als erstes Rehabilitierung und meint damit ein Ende aller diskriminierenden Praktiken gegen ihn und andere ehemalige politische Gefangene. So möchte er zum Beispiel einen unbefristeten Personalausweis haben, wie ihn alle anderen Indonesier über 65 Jahren erhalten. Auch hofft er, dass die indonesische Regierung die tatsächlichen Ursachen und Folgen der Ereignisse von 1965 und der nachfolgenden Massaker öffentlich aufklärt, so dass die Gesellschaft ihn nicht länger als Verräter und „bösen Kommunisten“ behandelt. Erst an letzter Stelle nennt er eine Entschädigung für das erlittene Unrecht. „Ich möchte weiterkämpfen – für mich selbst und andere. Wenn ich sterbe, möchte ich nicht allein und bedeutungslos in meinem Zimmer oder auf meiner Matratze sterben. Ich möchte im Kampf sterben, zwischen meinen Freunden. Das ist meine größte Hoffnung, etwas anderes wünsche ich mir nicht.“
Sumini: Ein normaler Arbeitstag endet mit fast zehnjähriger Gefangenschaft
Sumini wurde als Tochter eines Polizisten und einer Hausfrau in Banyumas, Mitteljava, geboren und arbeitete als Buchhalterin. 1954 begann sie, bei der Frauenorganisation Gerwani mitzuarbeiten, stieg zur Vorsitzenden des Lokalbüros in Wonosobo auf und arbeitete ab 1959 in der Bildungsabteilung der Organisation. Am 17. November 1965 kam ein Soldat des Distrikt-Militärkommandos (Komando Distrik Militer – Kodim) in Suminis Büro und fragte nach ihrem Ehemann, einem Sekretär der Indonesischen Bauernfront (Barisan Tani Indonesia – BTI). Da dieser zu einem Familienbesuch nach Bandung gereist war, forderte der Soldat Sumini auf, ihm auf die Wache zu folgen und dort ein Protokoll abzugeben. Er versprach ihr, dass sie bald wieder daheim wäre. Was folgte, waren fast zehn Jahre politische Gefangenschaft.
Eineinhalb Wochen nach ihrer Inhaftierung traf sie ihren Mann in dem selben Gefängnis, in dem auch sie ihr Schicksal abwartete. Dies war das letzte Mal, dass sie ihn sah. Während der nächsten Monate wurde Suminis Mann nach Wonosari in der Provinz Yogyakarta verlegt, wo er von einem ihrer Verwandten zum letzten Mal gesehen wurde. Viel später erfuhr Sumini, dass ihr Mann und tausende andere politisch unliebsame Personen ihr Ende in einem als Luwung Grubuk bekannten Abwasserkanal gefunden hatten. Man hatte die Opfer mit verbundenen Augen und Händen in den Kanal geworfen, der direkt in den Ozean floss.
Sumini selbst wurde mit 21 anderen Gefangenen nach Wirogunan in der Provinz Yogyakarta gebracht und nach mehreren Monaten in ein Frauengefängnis in Bukit Duri in Semarang verlegt. Für ihre angeblichen Verbrechen wurde sie nie vor ein Gericht gestellt. Ein einziges Mal wurde sie in ein Waisenhaus gebracht und von einem Staatsanwalt verhört, der sie der Unterwanderung der Staatsideologie Pancasila und der Teilnahme an einem militärischen Training bei Lubang Buaya beschuldigte. Aus Angst vor Folter und Vergewaltigung leistete Sumini nur geringen verbalen Widerstand gegen diese Anschuldigungen. Auch die Trennung von ihrer Familie macht Sumini zu schaffen. Ihre Kinder durften sie während ihrer gesamten Zeit in Gefangenschaft nicht besuchen. Von offizieller Stelle wurde ihnen mitgeteilt, dass ihre Mutter nach ihrer Verlegung nach Semarang gestorben war. Nur durch Zufall erfuhren sie von einem Verwandten, der in dem selben Gefängnis arbeitete, dass Sumini noch lebte. Sumini blieb in Gefangenschaft bis die Weltgesundheitsorganisation im Jahre 1974 begann, politische Gefangene zu besuchen und deren Haftbedingungen öffentlich zu kritisieren. Noch im selben Jahr wurde sie freigelassen.
Suminis Leben nach der Gefangenschaft
Nach ihrer Freilassung hatte Sumini mit dem Verlust ihres Mannes, ihrer Arbeitslosigkeit und sozialer Stigmatisierung zu kämpfen. Ihre Beamten-Registrierungsnummer (Nomor Induk Pegawai – NIP), sowie ihr Arbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung, den sie vor ihrer Stelle bei Gerwani innegehabt hatte, waren an eine andere Person vergeben worden, als hätte Sumini nie existiert. Eine Entschädigung für den Verlust ihrer Arbeitsstelle und die jahrelange illegale Gefangenschaft hat sie nie erhalten. Um sich und ihre Familie über Wasser zu halten, unterhielt sie eine kleine Garküche am Straßenrand. Zwar erleichterte die Unterstützung, die sie von ihrer Familie und Freunden in ihrer Kirchengemeinde erhielt, ihre schwierige Situation, doch war ihr Leben nie mehr so, wie es vor dem 30. September 1965 gewesen war. Da sie in den Augen der Gesellschaft das Stigma „PKI“ trug, wurde ihr mit Ausgrenzung und Verachtung begegnet. Über Jahre musste sie sich wöchentlich bei der örtlichen Polizeistelle melden. Ihr Personalausweis trug den Stempel „ET“ (ehemalige politische Gefangene), wodurch sie zu einer Bürgerin zweiter Klasse wurde. Auch ihre Kinder erfuhren diese Ausgrenzung bei der Suche nach Ausbildung und Arbeit.
Die Schicksale von Surati, Umar und Sumini sind keine Einzelfälle. Vielmehr stehen sie exemplarisch für unzählige Menschen in Indonesien, die wegen ihrer angeblichen Verbindungen zur PKI und dem Putsch vom 30. September 1965 gefoltert, eingesperrt und diskriminiert wurden und bis heute am Rande der Gesellschaft leben.