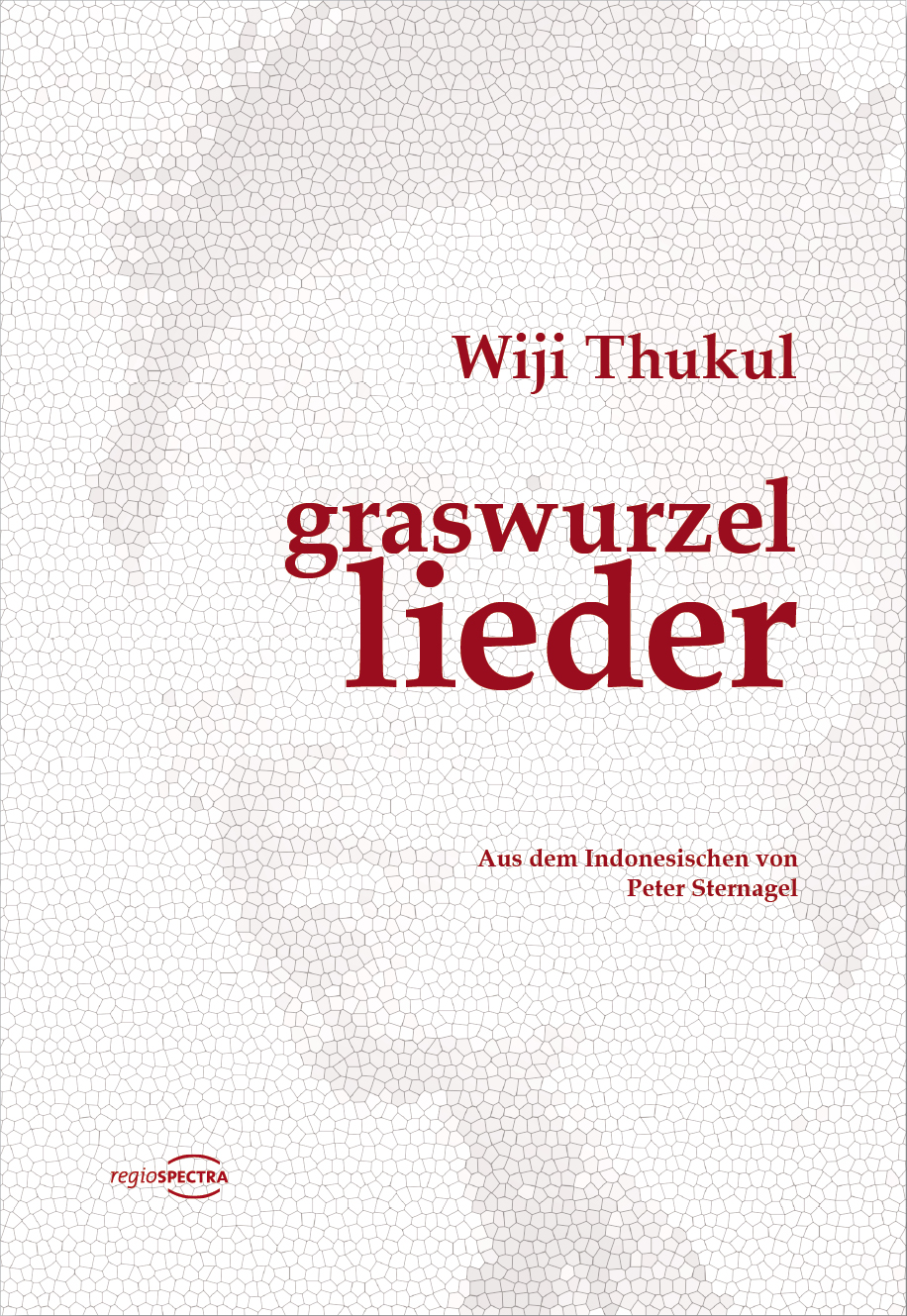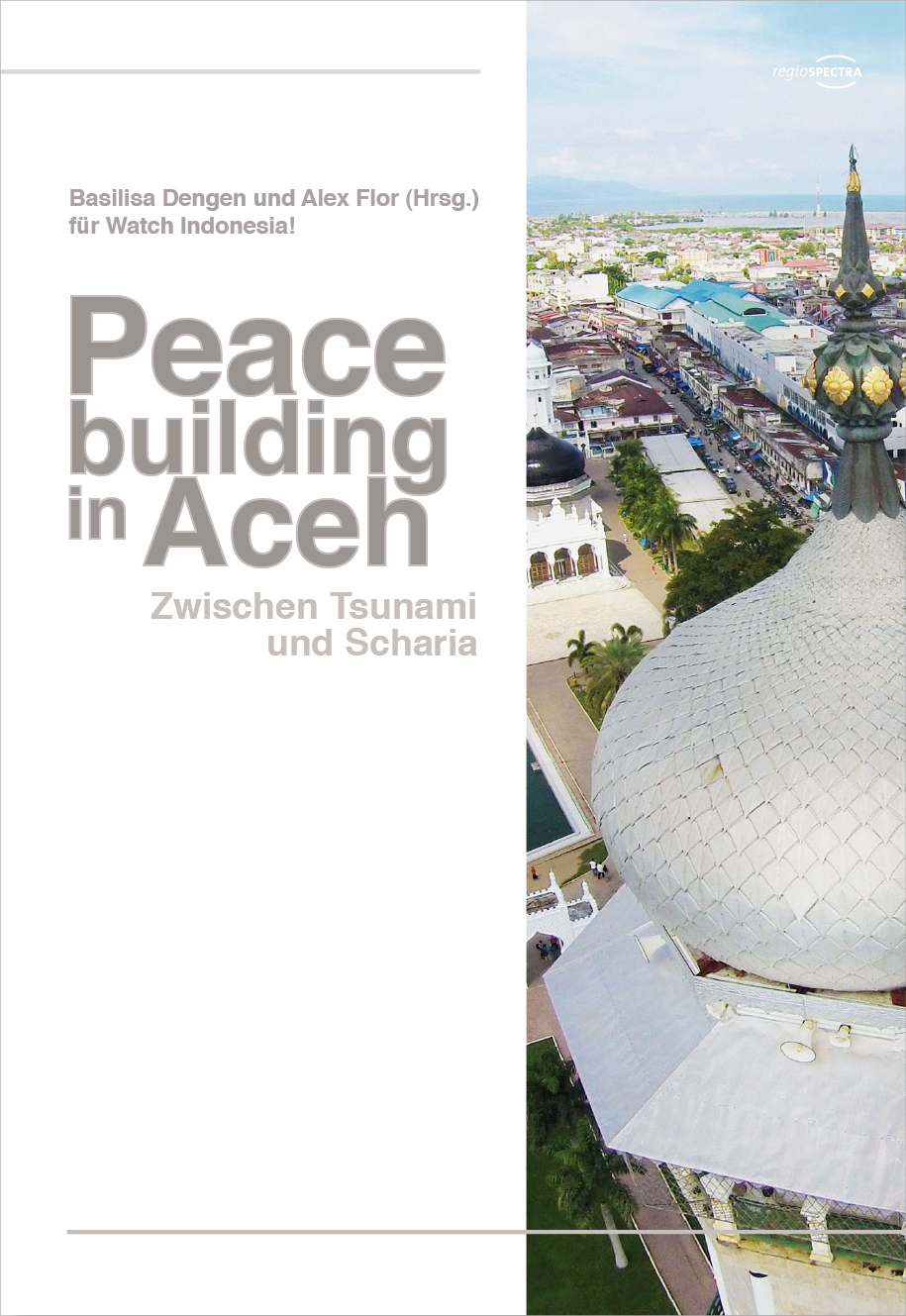Von der Idee des gerechten Friedens geleitet – Empfehlungen zu zivilen und militärischen Interventionen zum Schutz der Menschenrechte
Frankfurter Rundschau, 6. April 2004
Liebe Leserinnen und Leser, die Frankfurter Rundschau dokumentierte in ihrer Printausgabe vom 6. April 2004 die Empfehlungen zu zivilen und militärischen Interventionen zum Schutz der Menschenrechte in einer gekürzten Fassung und das komplette Kapitel auf ihrer Internet Seite unter: www.fr-aktuell.de/doku Das hier dokumentierte Kapitel „Ergebnisse und Empfehlungen“ ist dem von Thomas Hoppe herausgegebenen Buch entnommen: Schutz der Menschenrechte. Zivile Einmischung und militärische Intervention, Analysen und Empfehlungen. Vorgelegt von der Projektgruppe Gerechter Friede der Deutschen Kommission Justitia et Pax, Berlin: Verlag Dr. Köster 2004, 24,80 Euro, 303 S. ISBN 3-89574-521-9, (http://www.verlag-koester.de) Jede Regierung und jedes Militärbündnis, die um der Menschenrechte willen in die Belange anderer Staaten eingreifen wollen, müssen sich zuerst die politischen, ethischen und rechtlichen Fragen vergegenwärtigen, die mit dem Eingreifen verbunden sind. Die Autoren haben dazu Analysen und Empfehlungen vorgelegt. Das Projekt: Die Deutsche Kommission Justitia et Pax ist die von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gemeinsam getragene Fachstelle für Friedens-, Entwicklungs- und Menschenrechtsfragen. In ihr sind Verantwortliche der internationalen Arbeit der katholischen Kirche sowie Experten aus Wissenschaft und Politik tätig. Das hier vorgestellte Dokument wurde von der Projektgruppe „Gerechter Friede“ erarbeitet. Es will konkrete friedensethische und -politische Orientierungen geben im Blick auf Entscheidungen zu zivilen wie militärischen Interventionen in die Angelegenheiten anderer Staaten, die mit dem Argument des Menschenrechtsschutzes begründet werden. Hierzu werden u.a. Erfahrungen mit Interventionen in Somalia, Sierra Leone, Liberia, Ruanda (Volker Matthies), Bosnien/Kosovo (Peter Schlotter) und Osttimor (Monika Schlicher) ausgewertet. An der Durchführung des Projektes haben mitgewirkt: Dr. Klaus Achmann, Gemeinschaft Katholischer Soldaten, Berlin; Lothar Bendel, Zentrum der Bundeswehr für Innere Führung, Koblenz; Dr. Daniel Bogner, Deutsche Kommission Justitia et Pax, Bonn; Klaus Ebeling, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Strausberg; Joachim Gerstecki, Stiftung Adam von Trott, Imshausen; Dr. Hildegard Hagemann, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn; Prof. Dr. Thomas Hoppe, Universität der Bundeswehr Hamburg; Christoph Klitsch-Ott, Caritas International, Freiburg i. Br.; Prof. Dr. h.c. Karlheinz Koppe, Bonn; Prof. Dr. Volker Matthies, Universität Hamburg; Dr. Simone Rappel, missio München; Dr. Volker Riehl, Berlin (im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe AGEH, Köln; Dr. Monika Schlicher, Watch Indonesia!, Berlin; Prof. Dr. Peter Schlotter und Dr. Hans-Joachim Schmidt, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt/M.; Michael Steeb, AGEH, Köln; Dr. Reinhard Voss, Pax Christi, Bad Vilbel. Herzliche Grüße, Dr. Monika Schlicher (Watch Indonesia!)
D o k u m e n t a t i o n , L a n g f a s s u n g
Empfehlungen zu zivilen und militärischen Interventionen zum Schutz der Menschenrechte
Von der Deutschen Kommission Justitia et Pax
Jede Regierung und jedes Militärbündnis, die um der Menschenrechte willen in die Belange anderer Staaten eingreifen wollen, müssen sich zuerst die politischen, ethischen und rechtlichen Fragen vergegenwärtigen, die mit dem Eingreifen verbunden sind. Die Autoren haben dazu Analysen und Empfehlungen vorgelegt. Empfehlung 1: Die Problematik humanitärer Interventionen in der Leitperspektive des „gerechten Friedens“ reflektieren Jede Entscheidung über das Ob und Wie einer Einwirkung in die inneren Verhältnisse anderer Staaten, die um des Schutzes elementarer Menschenrechte willen erwogen wird, muss sich der damit verbundenen politischen, rechtlichen und ethischen Probleme bewusst sein. Eine solche Einmischung bedeutet oft auch dort, wo gravierende Gründe für sie sprechen, zunächst eine Beeinträchtigung der Souveränität und damit der Selbstbestimmungsmöglichkeiten derjenigen, in deren Gebiet sie stattfindet. Bereits allein wegen dieses unabweislichen Charakters von Fremdbestimmung muss sie daher mit Ressentiments, ggf. auch Widerstand rechnen. Darüber hinaus kann sie kontraproduktive Wirkungen entfalten, vor allem, wenn – wie bei umfassenden wirtschaftlichen Embargomaßnahmen – die getroffenen Maßnahmen nicht gezielt diejenigen erreichen, deren politischen Kurs sie ändern sollen, sondern womöglich eher jene schädigen, die ohnehin bereits als Opfer einer menschenrechtsverletzenden politischen Praxis anzusehen sind. Dies gilt um so mehr bei allen Formen bewaffneten Eingreifens. Hier kommt jedoch erschwerend hinzu, dass der Verlauf einer gewaltsamen Auseinandersetzung nur bedingt vorhersehbar ist – insbesondere besteht stets die Gefahr, dass infolge der Eigendynamiken der freigesetzten Gewalt Zerstörungen weit über das ethisch wie politisch Verantwortbare hinaus angerichtet werden. Militärisches Eingreifen kann daher in seinem Vollzug auch dort unerlaubt werden, wo eine Intervention vom Anlass her gerechtfertigt, wenn nicht sogar notwendig erscheint. Angesichts dieser nicht intendierten, aber regelmäßig absehbaren und generell nur schwer vermeidbaren negativen Folgen von Interventionen muss politisch mit aller Anstrengung nach Wegen gesucht werden, um Entscheidungslagen nicht erst eintreten zu lassen, in denen als ultima ratio nur die Wahl zwischen Optionen verbleibt, die man im Grunde allesamt ablehnt. Das Nachdenken über die Verbesserung von Möglichkeiten zielgerichteter Intervention darf nicht dazu führen, dass entschiedene Schritte hin zu mehr Gewaltprävention und zu einer multidimensionalen Menschenrechtspolitik, die auf die Veränderung politischer Strukturen in der Leitperspektive des „gerechten Friedens“ setzt, vernachlässigt werden. Nur dann lässt sich auch der Gefahr entgegenwirken, dass die Kräfte der internationalen Gemeinschaft wegen einer Vielzahl von Fällen, die aus unterschiedlichen Gründen die Frage nach einer Intervention aufwerfen können, rasch überfordert werden – mit der Folge unzureichender Mandate und eines defizitären Mitteleinsatzes, wodurch das ethisch-politische Ziel der Intervention verfehlt zu werden droht. In friedensethischer Hinsicht kommt der Frage, ob, wann und in welcher Weise Einmischungen bzw. Interventionen ein geeignetes Mittel zum Schutz der Menschenrechte und zur Förderung eines global verstandenen Gemeinwohls sein können, ausschlaggebende Bedeutung zu. Dieses Bewertungskriterium darf einzelstaatlichen Interessen anderer Art und Qualität nicht neben, erst recht nicht ihnen nachgeordnet werden. Nicht nur litte darunter die tatsächliche Legitimität solcher Einmischungen, auch würden Interventen unglaubwürdig in den moralischen Begründungen, die sie für ein Recht auf Intervention in Anspruch nehmen. Der politische Umgang mit der Interventionsproblematik muss sorgsam vermeiden, den Eindruck zu erwecken, auf diese Weise werde gewissermaßen der Relegitimierung des Krieges „durch die Hintertür“ das Wort geredet. Empfehlung 2: Die gewaltpräventiven Handlungsmöglichkeiten von Kirche und Zivilgesellschaft nutzen und erweitern Kirchliches und zivilgesellschaftliches Engagement mit dem Ziel einer gewaltpräventiven Konflikttransformation hat vor allem dort Aussichten auf Erfolg, wo bestimmte Eskalationsstufen noch nicht erreicht sind bzw. bereits durchschritten wurden. Während Phasen akuter Gewaltanwendung dürften sich konstruktive Formen des Einsatzes kirchlicher und gesellschaftlicher Akteure weitgehend darauf beschränken, (1) sich der Legitimierung bzw. der Beteiligung an der Anwendung von Gewalt zu ver-sagen, (2) unmittelbar Bedrohten bzw. Verfolgten zu helfen sowie (3) über das Geschehen zu informieren und so an der Mobilisierung von öffentlicher Aufmerksamkeit im Ausland mitzuwirken. Damit kirchliches und gesellschaftliches Engagement in einer gewaltgeneigten Umwelt stabilisierend wirken kann, sollten formelle oder informelle Netzwerkstrukturen zwischen denjenigen Kräften auf allen Seiten gebildet werden, die Gewalt ablehnen. Informelle Netzwerke funktionieren oft besser als formalisierte bzw. institutionalisierte. Für den kirchlichen Bereich gilt insbesondere, dass die eigenen Handlungsmöglichkeiten durch eine – materiell bzw. technisch, vor allem jedoch politisch unterstützte – Stärkung der Justitia-et-Pax-Strukturen erweitert werden können und sollten. Justitia-et-Pax-Kommissionen sind wichtige „Transmissionsriemen“ für die kirchliche Perspektive in die Zivilgesellschaft hinein. Sie können mit Konfliktbearbeitungsinitiativen in der Gesellschaft kooperieren, vor allem einen multilateralen Austausch von Erfahrungen im Bereich der Friedens- und Konfliktlösungsarbeit organisieren helfen (capacity building). Dies und eine überzeugende Konzeption für Erziehung und Bildung ist für substanzielle Friedensarbeit unverzichtbar. Gewaltprävention und Konfliktbearbeitung müssen jedoch Bestand-teil von Projektarbeit auf allen Ebenen werden, auch in der Pastoral, der Entwicklungszusammenarbeit, der kirchlich verantworteten humanitären Hilfe. Die Medienarbeit in- und außerhalb des Krisengebiets muss kritisch begleitet werden: Propaganda, die auf die Produktion von Feindbildern zielt und zunehmende Gewaltbereitschaft weckt, führt unter begünstigenden Umständen schnell zu physischer Gewaltanwendung in großem Umfang. Kirchliche und zivilgesellschaftlich getragene Medienarbeit müssen darauf gerichtet sein, ein Gegengewicht zu schaffen, das die Wirkung solcher Hetzkampagnen unterläuft. Sie müssen dabei jedoch zugleich sensibel für latente Gefahren sein: z.B. selbst Stereotypisierungen zu befördern oder klientelistische Interessen zu vertreten, aber auch, von falscher Seite unterstützt bzw. benutzt zu werden oder durch die Herstellung von Öffentlichkeit den so exponierten Personen ein zu hohes Risiko aufzubürden. Wo immer möglich, sollten kirchliche und zivilgesellschaftliche Akteure in aktuellen Konflikten zu vermitteln versuchen, um deren gewaltförmige Eskalation zu unterlaufen. Kirchenvertreter sollten insbesondere den innerkirchlichen Dialog zwischen Gruppen fördern, die aus politischen, sozialen, ethnischen oder anderen Gründen im Gegensatz zueinander stehen. Traditionelle Formen der Konfliktbearbeitung sollten daraufhin überprüft werden, wie weit sie in ein Konzept konstruktiver Konflikttransformation integriert werden können. Freilich darf das Bemühen um eine Mediation des Konflikts nicht darauf hinauslaufen, die Option für die Opfer in stark asymmetrischen Konflikten preiszugeben, ja die Vermittler ihrerseits in Systeme der Gewalt zu verstricken. Zur Unterstützung der Bemühungen von Kirchenvertretern und zur Stärkung ihrer politischen Rolle vor Ort kann advocacy-Arbeit von Ortskirchen in anderen (Nachbar-)Ländern überaus wichtig werden. Auch Versöhnungs- und Traumaarbeit, die das breite Spektrum der hier zu berücksichtigenden psychosozialen Aspekte einbezieht, sollten kirchliche bzw. zivilgesellschaftliche Akteure als ihre Sache verstehen – ebenso wie das Bemühen um eine Reintegration derjenigen, die durch Kriegs- und Gewalteinwirkungen aller Art ihren ursprünglichen Lebenszusammenhängen entrissen wurden. Gerade im Feld des zivilen Wiederaufbaus nach dem Ende von Gewaltphasen eröffnen sich vielfältige Handlungsmöglichkeiten für Initiativen aus dem Raum der zivilen Gesellschaft – sie sollten auch von kirchlichen Institutionen getragen und unterstützt werden. Ortskirchen in Europa können viel an Lobbyarbeit für Konfliktregionen in anderen Kontinenten leisten, indem sie auf die Regierungen europäischer Staaten einwirken, damit diese bei den dortigen Regierungen politisch intervenieren. Möglichkeiten hierzu liegen in einer advocacy-Arbeit im Menschenrechtsbereich, aber auch in qualifizierter Medienarbeit zu brisanten Konfliktsituationen. Freilich sollte solche Lobbyarbeit, ebenso wie andere Formen auswärtiger Einwirkung, so weit wie möglich im Konsens mit der jeweiligen Ortskirche umgesetzt werden – was nicht ausschließt, dass ggf. im innerkirchlichen Dialog abweichende Beurteilungen der konkreten Situation offen benannt werden müssen. Darüber hinaus können Partnerschaften zwischen einzelnen europäischen und nichteuropäischen Diözesen Prozesse anstoßen, die sich nicht nur innerkirchlich, sondern auch in anderen zivilgesellschaftlichen Formationen in einem Krisengebiet auswirken. Empfehlung 3: Politische Möglichkeiten einer gewaltfreien Einwirkung auf Konflikte mit Entschiedenheit nutzen und ausschöpfen Viele Situationen, in denen Gewaltanwendung als ultima ratio erscheint, könnten wahrscheinlich vermieden werden, würden die – als prima ratio – verfügbaren nichtmilitärischen Mittel der Einflussnahme auf krisenhafte Entwicklungen tatsächlich konsequent eingesetzt und das Spektrum der Möglichkeiten ausgeschöpft, die sie bereithalten. Dies verlangt von den Entscheidungsträgern – auf supranationaler wie nationaler Ebene – zunächst und vor allem einen hinreichenden politischen Willen, sich in Fragen des Krisenmanagements und der Gewaltprävention rechtzeitig zu engagieren. Für ein solches Engagement sprechen nicht nur ethische Gründe – wo man Menschen das mit organisierter Gewaltanwendung verbundene Leid ersparen kann, ist man verpflichtet, dies zu tun -, sondern auch die nutzentheoretische Überlegung, dass die Anforderungen und Kosten präventiver Politik meist deutlich hinter dem Umfang an Verpflichtungen zurückbleiben dürften, der infolge eines militärischen Eingreifens zu erwarten stünde. Gerade unter dem Gesichtspunkt von Prävention wird die Problematik vielfältiger interessen- und machtpolitischer Verflechtungen von Ländern des OECD-Raumes mit Krisenregionen und -gesellschaften erkennbar. Politische Entscheidungen sind deswegen kontinuierlich darauf zu überprüfen, ob durch sie riskiert wird, vorhandene Krisenpotentiale noch zu verschärfen und – statt zur vorausschauenden Transformation – eher zur weiteren Eskalation von gewaltträchtigen Situationen beizutragen. Darüber hinaus ist es erforderlich, die Mittel und Methoden der Frühwarnung vor sich zuspitzenden Konfliktsituationen zu verbessern, vor allem die Strukturen des politischen Entscheidungsapparats darauf-hin zu verändern, dass eine zeitgerechte Reaktion auf entsprechende Warnungen möglich wird. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und Regionalorganisationen wie der OSZE oder der EU sollte unter diesem Gesichtspunkt weiter intensiviert werden. Im Spektrum der Möglichkeiten direkter politischer Einflussnahme sind prinzipiell Anreizsysteme gegenüber ökonomischen Sanktionen zu bevorzugen, da letztere nicht nur offensichtlich den Charakter der Nötigung haben, sondern darüber hinaus viele Menschen treffen, die für die politischen Ursachen einer Konfliktsituation keine Verantwortung tragen. Sanktionsregimes sind deswegen auch nur dann gegenüber militärischen Interventionen vorzugswürdig, wenn sie ihren Zweck voraussicht-lich mit einem geringeren Ausmaß an Schädigungen jener Gruppen der Bevölkerung erreichen, die die Konsequenzen einer verfehlten Politik lediglich zu erleiden haben, ohne auf den Kurs ihrer politischen Führung tatsächlich Einfluss nehmen zu können. In jedem Fall müssen sich verstärkte Anstrengungen auf die Ausarbeitung praktisch umsetzbarer „intelligenter“ Sanktionen richten, die einen u.U. notwendigen politischen Druck ohne ungewollte Schädigung der Bevölkerung und ebenso ohne Griff zu physischer Gewaltanwendung zu erzeugen suchen. Zugleich bedarf es einer Fortentwicklung des gegenwärtigen Menschenrechtsschutzsystems, das trotz seiner durchaus nennenswerten Leistungsfähigkeit in zu hohem Maße von der faktischen Kooperationsbereitschaft menschenrechtsverletzender Regime abhängig ist. Ziel muss dabei eine wirksamere Absicherung der konsentierten Normen in der Praxis der Staaten sein. Empfehlung 4: Die Durchführung militärischer Interventionen von Anfang an unter den Imperativ der Schadensbegrenzung und des Schutzes der Zivilbevölkerung stellen In vielen Krisenregionen herrschen zum Zeitpunkt einer Interventionsentscheidung bereits katastrophale Verhältnisse, die Menschenrechte werden in großem Umfang missachtet, an öffentlicher Sicherheit fehlt es weitgehend, oft besteht auch eine verlässliche Basisversorgung der Bevölkerung nicht mehr. Die individuellen wie kollektiven psychosozialen Folgen von Lebensbedingungen unter ständiger Existenzangst sind nicht minder gravierend. Daher müssen Interventionen darauf abzielen, diesen Zuständen so rasch wie möglich Abhilfe zu schaffen; die Art und Weise ihrer Durchführung steht unter der Forderung, die Situation der am meisten Leid Tragenden nicht noch weiter zu verschlechtern. Humanitäre Hilfe, Aufklärung und Schutz der Bevölkerung müssen essentielle Bestandteile jeder Intervention sein. Klarheit und angemessener Umfang des Mandats von Interventionsstreitkräften, eine hinreichende personelle und materielle Ausstattung sowie adäquate Einsatzgrundsätze (Rules of Engagement) wie im „Brahimi-Report“ beschrieben – sind nicht nur entscheidend für die erfolgreiche Durchführung von Interventionen – sie sind zugleich eine unerlässliche Voraussetzung dafür, hierbei das Ziel einer wirksamen Schadensbegrenzung gerade für die Zivilbevölkerung so weit wie möglich verwirklichen zu können. Für die Umsetzung dieser Anforderungen tragen die Mitglieder des Sicherheitsrates, der über etwaige Interventionen zu befinden hat, die hauptsächliche Verantwortung; insbesondere müssen sie für eine ausreichende Finanzierung und realisierbare Mandate Sorge tragen. Nur so kann verhindert werden, dass das Scheitern von UN-Missionen, die von vornherein inadäquat mandatiert und ausgerüstet entsandt wurden, als Beweis einer mangelnden Eignung der Vereinten Nationen für Aufgaben der internationalen Friedenssicherung und des weltweiten Menschenrechtsschutzes erscheint. Um die mit einem bewaffneten Eingreifen verbundenen Schäden zu minimieren und kontraproduktive Auswirkungen möglichst zu vermeiden, bedarf es von vornherein einer so sorgfältig wie möglich ausgearbeiteten politischen Gesamtkonzeption für die Zeit nach dem Ende akuter Gewaltphasen (sustainable peace). Dies schließt die zeitgerechte Bereitstellung ziviler Komponenten ein, vor allem hinreichender Polizeikräfte. Wer sich zu einer Intervention entschließt, ist nicht frei, sich allein aufgrund pragmatischer Überlegungen wieder zurückzuziehen, er übernimmt vielmehr eine direkte Verantwortung für die politische wie persönliche Zukunftsperspektive der Menschen im Interventionsgebiet. Länger-fristige commitments können sich als unvermeidlich erweisen, auch wenn sie unerwünscht sind; ihre Bedeutung und das Ausmaß der mit ihnen eingegangenen Verpflichtungen dürfen daher gerade dort nicht ungenannt oder unterbestimmt bleiben, wo es gilt, die politische Zustimmung zu einer Intervention zu gewinnen (vgl. Empfehlung 8). Empfehlung 5: Auf strikte Völkerrechtskonformität und die Legitimierung durch die zuständigen Institutionen der Staatengemeinschaft bedacht bleiben Sollen Interventionen dem Anliegen des globalen Menschenrechtsschutzes auch auf längere Sicht dienen und in diesem Sinn eine nachhaltige Wirkung entfalten, so ist so weit wie möglich zu verhindern, dass in der Weise ihres Zustandekommens die Grundlagen supranationalen Rechts überhaupt ausgehöhlt werden. Es ist auch in Fällen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen nicht möglich, sich unmittelbar auf eine gewohnheitsrechtliche Legitimation für einzelstaatliche Interventionen zu berufen – die Zuständigkeit für derartige Entscheidungen liegt beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Jede Staatenpraxis, die die gegebene Rechtslage nicht respektiert, bietet Grund zu der Befürchtung, dass sie Präzedenzfälle für vergleichbare Rechtsverletzungen anderer Staaten setzt. Sie liefe damit Gefahr, einer weiteren Zunahme kriegerischer Gewaltanwendung in den internationalen Beziehungen den Weg zu ebnen und das gegenwärtige Friedenssicherungssystem dadurch zu untergraben. Der zu fordernde Respekt vor dieser Kompetenzzuweisung setzt andererseits voraus, dass die Mitglieder des Rats vor den ihnen zustehenden exklusiven Rechten einen sachgemäßen Gebrauch machen, insbesondere Interventionen zugunsten der Menschenrechte nicht dort blockieren, wo ihre Dringlichkeit offenkundig ist. Es bedarf daher einer Weiterentwicklung des internationalen Rechts mit dem Ziel, sicherzustellen, dass erforderliche Entscheidungen zu bewaffnetem Eingreifen aufgrund konsentierter materieller Rechtsstandards und möglichst frei von andersgelagerten politischen Opportunitätskalkülen getroffen werden können. Die entsprechenden Verfahrensregelungen in internationalen Gremien sind daraufhin zu reformieren, dass sie das Zustandekommen sachgerechter Beschlüsse fördern. Auch wenn gegenwärtig diskutierte konkrete Vorschläge hierzu aus unterschiedlichen Gründen noch nicht überzeugen können, muss die Suche nach konstruktiven Modifikationen des gegebenen Systems, nach transparenten und zugleich effizienten wie rechtlich überprüfbaren Entscheidungswegen fortgeführt werden. Fortschritte erscheinen ferner im Hinblick auf die geltenden Standards im humanitären Völkerrecht notwendig, die die Opfer bewaffneter Konflikte nicht hinreichend zu schützen vermögen – zumal angesichts gewandelter Konfliktaustragungsformen und sich verändernder technischer Möglichkeiten zum Einsatz von Gewalt. Auch mit den Mitteln des Rechts sollte versucht werden, den schwer beherrschbaren Eigendynamiken jeder organisierten Gewaltanwendung und den damit einher ge-henden Eskalationsgefahren so weit wie möglich Dämme zu setzen. Daher gilt es zum einen, alle Staaten dazu zu bewegen, die Standards der Zusatzprotokolle im eigenen Zuständigkeitsbereich verbindlich zu machen – vorzugsweise auf dem Weg des Beitritts zu diesen Vertragswerken. Zum anderen sollten Verhandlungsprozesse initiiert bzw. weitergeführt werden, die auf eine Fortbildung und Verstärkung der humanitären Schutznormen des Völkerrechts, über den Rahmen der Zusatzprotokolle hinaus, gerichtet sind. Vor allem jedoch müssen Verstöße gegen die bereits verpflichtenden humanitären und menschenrechtlichen Rechtsvorschriften in angemessener Weise geahndet werden. In diesem Kontext kann der jüngst ins Leben gerufene Internationale Strafgerichtshof eine zusätzliche wichtige Funktion erfüllen. Dies gilt einerseits im Blick auf die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung: Vergleichbare Delikte ließen sich auch in vergleichbarer Weise völkerstrafrechtlich würdigen. Andererseits ist mit der Errichtung des Gerichtshofs ein deutliches politisches Signal verbunden: Staaten, die Verstöße ihrer Soldaten gegen geltendes humanitäres Recht nicht hinreichend oder überhaupt nicht ahnden, können künftig nicht mehr davon ausgehen, dass es mit solchen faktischen Amnestierungen sein Bewenden haben wird. Empfehlung 6:In der Planung und Durchführung Humanitärer Hilfe mit Zielkonflikten rechnen und Strategien zu ihrer Minimierung ausarbeiten Hilfsorganisationen sehen sich in ihrer Arbeit in Krisengebieten mit Zielkonflikten konfrontiert, die nicht in jedem Fall vermeidbar sind, bestenfalls auf ein annehmbares Maß verringert werden können. So stehen sie häufig vor dem Problem, dass von ihren auf die Bedürftigsten gerichteten Hilfsprogrammen zugleich die Vertreter von Konfliktparteien profitieren. Wo dies in Kauf genommen werden muss, um elementare Überlebenshilfe für die Opfer bewaffneter Konflikte überhaupt leisten zu können, kann es nur darum gehen, solche ungewollten Transferwirkungen so weit wie möglich zu minimieren; eine totale Verweigerung von Hilfslieferungen wäre angesichts ihrer Konsequenzen für die eigentlichen Adressaten nicht zu rechtfertigen. Durch entsprechendes Management und Kontrolle muss sichergestellt werden, dass das Gros der Hilfe die jeweiligen Zielgruppen erreicht. Ebenso ist nach Möglichkeit zu vermeiden, dass Humanitäre Hilfe einseitig nur bestimmten Gruppen der Bevölke-rung zufließt, obwohl sich andere in einer ähnlich desolaten Lage befinden, oder dass sich Hilfslieferungen hemmend auf den Aufbau nachhaltiger lokaler Wirtschaftsstrukturen auswirken. Um diesen unerwünschten Effekten gegensteuern zu können, ist ein hohes Maß an Professionalisierung des eingesetzten Hilfspersonals erforderlich, das vor allem in die Lage versetzt werden muss, die Risiken ambivalenter Wirkungen der geleisteten Hilfe abzuschätzen. Spannungen lassen sich ferner durch Offenheit in der Art der jeweiligen Projektdurchführung abbauen. Informationen an alle relevanten Gruppen über das humanitäre Mandat einer Organisation und die Ziele und Mittel des Projekts können Misstrauen vermindern. Die Partizipation der Empfänger und des Umfeldes an Planung und Durchführung können ebenfalls konfliktmindernd wirken. Nicht intendiert, aber um des Zugangs zu Hilfsbedürftigen willen häufig unvermeidlich ist eine Zurückhaltung Humanitärer Hilfsorganisationen hinsichtlich berechtigter, ja notwendiger Kritik an den politischen Verhältnissen in Krisengebieten, z.B. an schweren Menschenrechtsverletzungen, die durch verbrecherische Regime verübt werden. Die Rücksicht auf das Interesse an Schutz und Hilfe für Notleidende kann u.U. selbst die öffentliche Artikulationsfähigkeit von Menschenrechtsorganisationen beeinträchtigen, wenn die offene Benennung solcher Verbrechen die Fortsetzung der eigenen Arbeit oder derjenigen der humanitären Helfer unmöglich werden ließe. Ein Spannungsverhältnis kann sich außer-dem aus unterschiedlichen Handlungslogiken ergeben. Die Praxis humanitärer Hilfsorganisationen, die sich dem Neutralitätsgebot verpflichtet sehen, folgt oft anderen Grundsätzen als militärisch-strategische Planungen, welche neben den humanitären weiter gesteckte politische Zielsetzungen zu erreichen suchen. In solchen Fällen ist sicherzustellen, dass die humanitären Prioritäten, mit denen eine Intervention begründet wird, nicht andersartigen militärischen und politischen Zielen untergeordnet werden. Darüber hinaus ist mit einem grundlegenden Zielkonflikt zu rechnen, der kaum auflösbar erscheint: Militärische Absicherung Humanitärer Hilfe für einzelne Zielgruppen richtet sich unvermeidlich gegen bestimmte Akteure des Konfliktgeschehens und kollidiert so mit der Neutralitätsverpflichtung der Helfer, kann aber die einzige Option darstellen, um eine durch Gewaltakte an Leib und Leben gefährdete Zivilbevölkerung ebenso zu schützen wie das Hilfspersonal selbst. Der Verzicht auf diese Absicherung würde dann darauf hinauslaufen, hilflose Menschen ihrem Schicksal zu überlassen. Dies wäre nicht nur für viele der Beteiligten unerträglich, es würde auch die moralische Glaubwürdigkeit beschädigen, mit der man sich in der Legitimation einer Intervention auf humanitäre Zielsetzungen beruft. Gerade mit Blick auf solche real möglichen Situationen sollte daher zwischen militärischen und zivilen Einsatzkräften bereits vor Beginn einer Mission Einvernehmen darüber hergestellt werden, wie im Ernstfall zu handeln ist. Empfehlung 7: Einsatzgrundsätze für Interventionsstreitkräfte am Ziel der Gewaltminimierung und am Respekt vor den Menschenrechten und den Normen des humanitären Völkerrechts ausrichten Die Anwendung kollektiver Gewalt verläuft in den seltensten Fällen so, wie es Planer zuvor konzipiert hatten. Dadurch wächst das Risiko, dass die ethischen und rechtlichen Forderungen nach einer Begrenzung des Gewaltniveaus im Ernstfall gewissermaßen „leer laufen“ – und es wird um so größer, je länger die Gewaltphase andauert und je mehr sich die wechselseitige Gewaltanwendung intensiviert. Wenn andererseits die Entscheidung, auf Gewaltanwendung zu verzichten, angesichts ihrer Konsequenzen für Dritte unannehmbar ist, bleibt nur die Möglichkeit offen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen alles zu unternehmen, was die Chancen für eine ethisch-rechtliche Einhegung der Anwendung von Gewalt und für die Kontrollierbarkeit ihrer Folgen erhöht. Generell muss der Versuchung widerstanden werden, bei der Definition erlaubter Zielkategorien, bei der Auswahl der Ziele selbst, der gegen sie einzusetzenden Waffen und der konkreten Art ihrer Verwendung das geltende Recht weit auszulegen, und zwar zu Lasten der zu Schützenden. Bestehende Unklarheiten bzw. zu weite Ermessensspielräume im geltenden Recht müssen daher beseitigt werden (vgl. Empfehlung 5). Die für den Einsatz im Rahmen von Interventionen vorgesehenen Personen bedürfen einer Sensibilisierung für die ethischen Aspekte bzw. Konsequenzen vieler der ihnen u.U. abverlangten Einzelentscheidungen, darunter ausdrücklich auch für die ethischen wie rechtlichen Grenzen von Befehl und Gehorsam. Die Herausbildung von Aufmerksamkeit dafür, wie leicht sie in den Sog der Eigendynamiken der Gewalt geraten können, kann verhindern, dass Angehörige von Interventionstruppen selbst schwere Verletzungen der Menschenrechte und der Normen des humanitären Völkerrechts begehen. Präventiv wirksam werden kann nicht erst eine nachträgliche Sanktionierung von Verstößen, sondern nur eine hinreichend systematisch durchgeführte Bewusstseinsbildung in Fragen des humanitären Völkerrechts und Menschenrechtsfragen, z.B. durch entsprechende Ausbildungsprogramme während der Einsatzvorbereitung. Für die Bundeswehr besteht eine besondere Verpflichtung auf den Menschenrechtsschutz bereits im Rahmen der verbindlichen Grundsätze der Inneren Führung. Allerdings gilt es gerade im Kontext multinationaler Einsätze der Gefahr entgegen zu wirken, dass diese Prinzipien und die ihnen entsprechenden Soldatenrechte unter Druck geraten, weil sie nicht in Übereinstimmung mit der Praxis und Tradition anderer Armeen stehen. Statt eine allmähliche Relativierung dieser rechtlichen Standards zu akzeptieren, muss daher auf politischer Ebene mit Entschiedenheit an ihrer Stärkung und weiteren Verbreitung gearbeitet werden. Auf die Verpflichtung auf die Menschenrechte ist ausdrücklich auch hinsichtlich der Behandlung von Gefangenen hinzuweisen. Selbst dort, wo man einem Inhaftierten den Kriegsgefangenenstatus nicht zuerkennt, wird dieser deswegen keineswegs zu einer rechtlosen Person. Seine Menschenwürde ist weiterhin in der Weise, wie er behandelt wird, zu respektieren; insbesondere stellen die auch in Krisensituationen nicht derogierbaren Menschenrechte rechtlich verbindliche Schutznormen dar, die gegenüber jedermann gelten. Empfehlung 8: Eine koordinierte Bearbeitung der vielfältigen Aufgaben im Bereich der Konfliktnachsorge und Friedenskonsolidierung sicherstellen Bereits zu Beginn einer Intervention, nicht erst der Aufgabendefinitionen nach dem Ende der Gewaltphase, bedarf es der Bereitschaft der Staatengemeinschaft, sich auf eine längere aktive Verantwortungsübernahme für die künftige Entwicklung in einem Interventionsgebiet einzurichten, um die dort regelmäßig notwendigen strukturellen Wandlungsprozesse zu unterstützen. Dies fordert nicht nur die Bereitstellung von Ressourcen, es stellt vor allem entsprechende Anforderungen an eine effizienz-orientierte Kohärenz und Koordination im Vorgehen unterschiedlicher externer Akteure. In vielen Fällen wird die Hauptverantwortung von Interventionsmächten nach dem Ende der militärischen Auseinandersetzungen auf die Wiederherstellung eines Zustands gerichtet sein müssen, der der Bevölkerung im betroffenen Gebiet elementare Überlebensbedingungen sichert. Darüber hinaus gilt es, den erreichten Waffenstillstand dagegen abzusichern, dass die Situation nach kurzer Zeit in neue Gewaltanwendung zurückfällt. Bemühungen um eine Demilitarisierung des Konflikts müssen Entwaffnungs-Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen für ehemalige Kämpfer, insbesondere für Kindersoldaten, mit Priorität versehen. Bereits frühzeitig muss überdies mit weitreichenden Reformen des Sicherheitssektors begonnen werden. Jenseits der Gewährleistung elementarer Versorgung und Sicherheit für die Bevölkerung im Interventionsgebiet steht die Staatengemeinschaft vor der Aufgabe, einen umfassenden inneren Wandel im Lande einzuleiten, der das Wiedererstehen von Verhältnissen, die seinerzeit zum Interventionsgrund wurden, möglichst unwahrscheinlich werden lässt. Grundsätzlich sollten sich stark wirksame und spürbare Eingriffe von außen darauf beschränken, die Bedingungen zu schaffen bzw. sicherzustellen, unter denen ein menschenrechtsfreundlicher Transformationsprozess gelingen kann. Ohne eine sich konsolidierende und politisch zunehmend artikulationsfähige Zivilgesellschaft dürfte es überaus schwierig werden, in Richtung auf – möglichst kulturell angepasste – Modelle politischer Partizipation und Demokratisierung Fortschritte zu machen, die mit einer Perspektive auf dauerhafte Transformation verbunden sind. Allein an der Durchführung von Wahlen unter internationaler Aufsicht lässt sich nicht ablesen, wie weit ein politischer Konsolidierungsprozess im Land bereits vorangeschritten ist. Es gehört vielmehr zur Verantwortung der Staatengemeinschaft, zu verhindern, dass als Ergebnis solcher Wahlen Personen an die Macht gelangen, die erwarten lassen, dass die begonnene Transformation der politischen und gesellschaftlichen Situation wieder revidiert wird. Ferner bedarf es der Einrichtung geeigneter Rechtssysteme, aber auch korrespondierender politischer Institutionen, die einen wirksamen Menschenrechts- und Minderheitenschutz garantieren können. Zudem sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, zum Aufbau einer veränderten politischen Kultur beizutragen, insbesondere der Neukonstitutierung unabhängiger Medien den Weg zu bereiten. Von besonderer Bedeutung ist außerdem die Bekämpfung aller Erscheinungsformen von Korruption und organisierter Kriminalität, besonders in ihren schlimmsten Ausprägungen, wie sie im Menschenhandel (Zwangsprostitution), im Drogen- und Waffenhandel begegnen. Externe Unterstützung in erheblichem Umfang ist unverzichtbar, sollen Regionen, die durch die Erfahrung kollektiver, organisierter Gewaltanwendung tief erschüttert wurden, auf den Weg einer sich in absehbarer Frist auch ökonomisch selbst tragenden Entwicklung zurückgeführt werden können. Wo in langjährigen gewaltsamen Konflikten staatliche Strukturen zerfallen sind und sich stattdessen regelrechte Gewaltökonomien etablieren konnten, besteht eine Hauptaufgabe für externe Akteure nach dem Abschluss einer militärischen Intervention darin, für viele Beteiligte einen Ausstieg aus diesen Gewaltökonomien zu ermöglichen, ja attraktiv werden zu lassen. Aufbauhilfen sollten daher auch darauf abzielen, der Bevölkerung in zunehmendem Maße zivile Einkommensmöglichkeiten zu erschließen. Zugleich muss das Eindringen von in Gewaltökonomien erzeugten Gütern in die formelle Wirtschaft erschwert werden. Ein bedeutsamer Schritt wäre der Boykott von Rohstoffgütern aus Konfliktregionen, wenn der Handel mit ihnen nachweislich zur Verlängerung von Kriegen beiträgt. Zudem sollte die Einfuhr von Waffen in diese Regionen strikt unterbunden werden. Sorgfältig zu bestimmen ist der Zeitpunkt, zu dem mit einer strafrechtlichen Aufarbeitung von systematischen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begonnen werden kann. Diese Aufgabe kann erst in Angriff genommen werden, wenn keine Gefahr mehr droht, dass der prioritäre Schutz vor neuer Gewaltanwendung dadurch in Gefahr geriete. Generelle Amnestien sollten vermieden werden, weil sie regelmäßig dazu führen, dass die bisherigen Funktionseliten erhalten bleiben und ein breitenwirksamer Prozess der Auseinandersetzung mit dem Unrechtscharakter überwundener Systemstrukturen verhindert wird. Dadurch gerät jedoch die Legitimität der neuen politischen Ordnung auch bei den Opfern überwundener Unrechts- und Gewaltverhältnisse ins Zwielicht, obwohl sie auf deren Unterstützung wesentlich angewiesen ist. In manchen Situationen mag die Kombination von strafrechtlicher Verfolgung und einer öffentlichen Aufarbeitung der Vergangenheit im Rahmen von Wahrheitskommissionen empfehlenswert erscheinen; keinesfalls stellen jedoch Wahrheitskommission eine Alternative dar, die strafrechtliche Verfolgung schwerer Verbrechen überflüssig machen könnte. Angesichts der Unzulänglichkeiten strafrechtlicher Aufarbeitung bleibt eine Fülle weiterer Aufgaben zu bewältigen, wenn es gelingen soll, die Tatfolgen vergangener Verbrechen für die überlebenden Opfer und die Gesellschaft insgesamt zu lindern. Bemühungen um eine Reintegration von Menschen, die durch erlittene Gewalterfahrungen auf unterschiedliche Weise ihrem bisherigen sozialen Umfeld entrissen wurden, müssen multidimensional ansetzen. Für Flüchtlinge und Vertriebene bedeutet dies auf absehbare Zeit vor allem, Lebens und Einkommensmöglichkeiten in der Nähe derjenigen Orte zu schaffen, in denen die Flüchtenden bzw. Vertriebenen sich bei Ende der Gewaltphase tatsächlich befinden. Nur so weit die Verhältnisse in ihren ursprünglichen Herkunftsgebieten es vertretbar erscheinen lassen, darf auf ihre Rückkehr hingewirkt werden. Zugleich bedarf es für alle Bevölkerungsgruppen einer zügigen Wiedererrichtung grundlegender sozialer Sicherungssysteme und eines wenigstens halbwegs gerecht zu nennenden Verteilungssystems, womöglich auch der zerstörten „sozialen Netzwerke“. Durch die grundlegende Rekonstruktion des sozialen Systems werden Wege eröffnet, auf denen das dringend benötigte „Human- und Sozialkapital“ in der Bevölkerung für eine sich längerfristig selbst tragende friedliche Entwicklung herausgebildet werde kann. Am Beispiel der überaus schwierigen Wiedereingliederung von Kindersoldaten lassen sich die Herausforderungen und Schwierigkeiten verdeutlichen, die sich für den Versuch einer Bearbeitung von Traumatisierungen ergeben. Unter traumatischen Erfahrungen leiden jedoch nicht nur Opfer von Gewalt in Kriegen und Bürgerkriegen – schwere Traumatisierungen können auch die Folge vormaliger repressiver Gewaltstrukturen in autoritären bzw. diktatorischen Systemen sein. Eine Gesellschaft, die sich die Frage nach einem angemessenen Umgang mit ehemaligen Tätern nicht leicht macht, muss zugleich ebenso entschieden danach streben, den Opfern von Unrecht und Gewalt praktische Hilfe anzubieten. Insbesondere zivilgesellschaftlichen Akteuren sollte es deswegen darum gehen, den Umfang jeweils der konkreten Situation angepasster psychosozialer Hilfsangebote zu erweitern, und sie sollten dabei durchaus auch das jeweils vor Ort vorhandene, oft an traditionelle Formen gebundene Wissen um den Umgang mit Traumatisierungen berücksichtigen. Dabei müssen sie der Tatsache Rechnung zu tragen, dass eine angemessene Bearbeitung der psychosozialen Folgen von Traumatisierungen längere Zeiträume benötigt und akute Kurzzeit-Interventionen nur sinnvoll erscheinen, wenn sie eine solche längerfristige Perspektive mit eröffnen. Bemühungen um Aufarbeitung der Vergangenheit auf gesellschaftlicher und politischer Ebene sollen den Entstehungsbedingungen dafür entgegenwirken, dass sich vergleichbare Strukturen von Gewalt bzw. systemisch bedingtem Unrecht von neuem herausbilden. Die Erfolgsaussichten solcher Bemühungen hängen aufs Engste damit zusammen, wie weit es gelingt, im Raum der Öffentlichkeit früher zu Unrecht Verurteilte oder Benachteiligte zu rehabilitieren und wenigstens teilweise zu entschädigen. Solche Akte sind zwar zunächst im Hinblick auf die individuelle Lebenssituation der Betroffenen von großer Bedeutung, nicht minder sind sie es jedoch wegen ihrer symbolischen Funktion für die öffentliche Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, d.h. in politischer und kultureller Hinsicht. Durch öffentliche Ehrungen der Opfer, Gedenkstättenarbeit, historisch wie didaktisch mit Sorgfalt konzipierte Publikationen, Medienarbeit und die Thematisierung dieser Problematik im Bereich von Erziehung und Bildung kann es gelingen, Formen kollektiver Erinnerung vor politischer Manipulation zu schützen. Selbst die Aussichten für den Erfolg individueller Traumabearbeitung hängen entscheidend davon ab, ob diese in einem öffentlichen Klima stattfindet, das eine Offenlegung der Verursachungsfaktoren für die entstandenen Traumatisierungen ermöglicht.